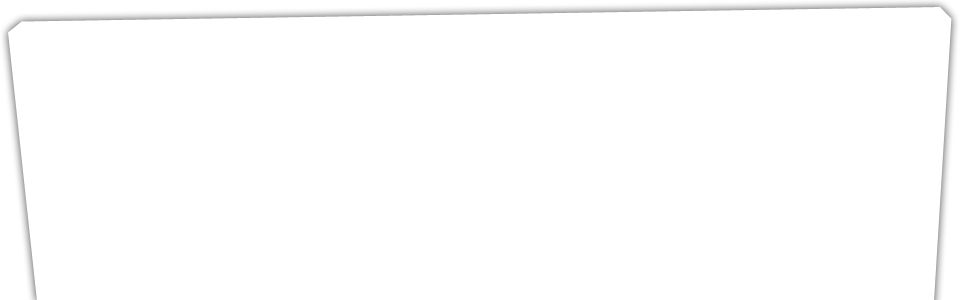Infomail
Du möchtest die monatliche Infomail vom Jugendwerk erhalten? Dann sende uns eine Email an:
Sommerzeit = Ferienzeit = Fahrten & Aktionen & viel Spaß!

Das Team im Jugendwerk Altholstein wünscht euch Sonnenliebhabern, euch Urlaubfahrern, euch Schulabgängern und euch Freizeitgenießern eine schöne Sommerzeit!
Wir hoffen, dass ihr schöne Erlebnisse sammeln werdet und euch auch ein wenig erholen könnt!
Passt gut auf euch auf und kommt sowohl gut in die Ferien rein als auch wieder heil aus den Ferien raus.
Wir freuen uns über eure Erlebnisberichte und natürlich euch auch nach den Ferien wiedersehen zu können.
Habt eine segensreiche und Zeit und genießt sie, denn ihr habt sie euch mehr als nur verdient!!!
Euer Team aus dem Jugendwerk
Freie FSJ Stelle zum 01.09.2024
Wir vergeben noch 1 der 2 FSJ Stellen mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit und/oder Jugendkirche

Schule ist fast vorbei und dann?
Du hast ein Jahr Zeit für die Ev. Jugendarbeit?
Dann los: Absolviere Dein FSJ/BFD bei uns!
Schwerpunkte im Arbeitsfeld der außerschulischen Jugendbildung:
- Unterstützung und Durchführung von Seminaren
(z.B. Juleica-Ausbildungen, JiMs Bar) - Mitorganisation von Veranstaltungen
(z.B. JiMs Bar-Einsätze, Kirchentagsfahrten & -Aktionen und Angebote beim Weltkindertag) - Zusammenarbeit und Unterstützung der Jugendgremien des Jugendwerkes
- Mitgestaltung der Werbung für die Angebote des Jugendwerkes in den Print- und digtialen Medien (z.B. Homepage, Soziale Medien, Messenger)
Schwerpunkte im Arbeitsfeld der Jugendkirche:
- Entwicklung jugendgemäßer Veranstaltungsformate (z.B. Poetry-Slam, Jugendbands und Konzerte)
- Mitorganisation von Veranstaltungen (z.B. Konfirmand_innen-Tage und Gottesdienste)
- Unterstützung und Durchführung von Jugendgottesdienstwerkstätten
- Mitgestaltung der Werbung für die Angebote des Jugendwerkes in den Print- und digtialen Medien (z.B. Homepage, Soziale Medien, Messenger)
Wünschenswert:
Du bist mindestens 18 Jahre alt
Einen Führerschein der Klassen B,BE oder B96 besitzt
(Beides ist jedoch kein Ausschlussgrund)
Wir würden uns über folgende Interessen und Fähigkeiten freuen:
- Erfahrung in der evangelischen Jugendarbeit (gerne eine Juleica)
- Die Fähigkeit sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten
- Fit in Kommunikation & in Office-Anwendungen
- Bereitschaft auch zu ungewöhnlichen Zeiten tätig zu werden
(z.B. Wochenenden & abends)
Wir bieten Dir:
- Ein abwechslungsreiches Jahr mit interessanten Tätigkeiten
- Weiterbildungsmöglichkeiten (5 Seminare im Laufe des Jahres)
- Mitarbeit in einem engagierten Team
- Zahlung eines Taschengeldes und eines Verpflegungskostenzuschusses
- Möglichkeiten zur Übernahme von Verantwortung
- Betreuung des FSJ/BFD durch das Diakonische Werk Schleswig - Holstein
Wir freuen uns über Deine Bewerbung und auf Dich & Deine Ideen!
Dein Team im Jugendwerk Altholstein
Du möchtest ein Freiwilliges Soziales Jahr in der außerschulischen Jugendbildung oder in der Jugendkirche, dann bewirb Dich mit Deinen üblichen Bewerbungsunterlagen bei uns im Jugendwerk Altholstein, Am Alten Kirchhof 5, 24534 Neumünster!
Die Bewerbungsfrist endet am 30.06.2024! Es gilt der Posteingangsstempel!
Was ist ein FSJ?!
Das Freiwillige Soziale Jahr bietet die Möglichkeit, für maximal 18 Monate in einer sozialen Einrichtung mitzuarbeiten und somit Menschen zu helfen und selbst wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Durch die Arbeit in einer sozialen Einrichtung (Jugendwerken, Kindergarten, Pflegeheim, Behindertenwerkstatt, Krankenhaus, u.a.) gewinnt man erste Einblicke in das Berufsleben und sammelt wichtige persönliche Erfahrungen. Neben der täglichen Arbeit in den Einrichtungen finden verpflichtende Seminare statt, in denen sich die Freiwilligen über ihre Arbeit austauschen und sich mit Themen aus unterschiedlichen Bereichen beschäftigen. Die Seminare können allgemeine, gesellschafts-, einrichtungs- oder arbeitsfachspezifische Themen beinhalten. Hinzu kommen erlebnis- und freizeitpädagogische Aktionen und Ausflüge, die den Horizont erweitern. Dabei ist auch Raum für Kreativität und eigenes Engagement.
Wenn Du Interesse an der Stelle haben oder noch Fragen zur Stelle hast, dann wende Dich vertrauensvoll an uns. Unsere Kontakdaten sind auf dieser Hompepage veröffentlicht.
JiMs Bar an der Jungen Bühne Kiel zur Kieler Woche
In diesem Jahr wollen wir wieder aktiv die Junge Bühne Kiel unterstützen!
- Ort: Ratsdienergarten an der Jungen Bühne Kiel
- Zeitraum: 22. Juni bis 29. Juni 2024
- Uhrzeit: Um 15:00 Uhr beginnen wir mit dem Aufba und 16:00 Uhr wollen wir die JiMs Bar öffnen. Spätestens um 23:00 Uhr wollen wir die Bar bereits wieder geschlossen und aufgeräumt für den nächsten Tag haben.
- Begleitung: Min. eine hauptamtliche Person wird immer vor Ort sein und Euch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
- Schichtplan: Für den Schichtplan bitte hier klicken...
ACHTUNG: Bitte auch die Anmerkungen unter der Abfrage lesen. Das ist ganz WICHTIG!!! Dankeschön!!!
- Cocktails: Ev. Jugend Spezial, Ipanema, Coladas, Blue Lagoon, Moonlight und der diesjährige, offizielle, alkolofreier Kieler Woche Cocktail: Red Vulcano
Solltest Du noch Fragen haben, dann wende Dich gerne an Björn!
Seine Kontaktdaten findest Du, wenn Du hier klickst...
Probeshaken & Auffrischung § 43 (5) Infektionsschutzgesetz
Am 31. Mai 2024, ab 17:00 Uhr in der Thomasgemeinde Kiel Mettenhof
An diesem Abend wollen wir uns ab 17h im Jugendbereich der Thomasgemeinde, Skandinaviendamm 350, 24109 Kiel treffen und den neuen Kieler Woche Cocktail kennenlernen und versuchen ihn selbst zu erstellen!
Natürlich nutzen wir unsere Zusammenkunft auch, um uns noch einmal die Hygienebelehrung nach § 43 Abs. 5 Infektionsschtzgesetz aufzufrischen!
Gemeinschaft soll dabei aber auch nicht zu kurz kommen. Es wird sicherlich eine Kleinigkeit zum Schnabulieren geben und wir können uns alle ein wenig besser kennenlernen. Wer weiß, mit welcher "NEU kennengelernter Person" Du bei der Kieler Woche zusammen auf dem Wagen stehst?! :-)
Bitte meldet Euch im Vorwege für diesen Abend bei uns im Jugendwerk ( Jugendwerk[at]altholstein.de ) an, damit wir besser planen können und für alle was dabei haben.
Wir freuen uns auf einen netten Abend mit Euch in der Thomasgemeinde Kiel!
Euer Vorbereitungsteam
Anmeldeformular findest Du hier...